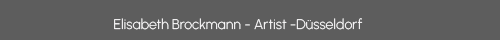Margarethe von Trotta
Eröffnungs-Rede für Elisabeth Brockmann
Vom Sehen und Gesehenwerden
Wenn Elisabeth mich in Paris besuchen kommt, bringt sie jedesmal eine lange Liste mit von dem, was sie sich ansehen möchte. Paris, city of architecture and design, und dann führe nicht ich sie durch die Stadt, was normal wäre, sondern sie mich. Und sehr oft in Straßen und an Plätze, die ich noch nie gesehen habe. Auf diese Weise habe ich gelernt, Paris mit anderen Augen zu betrachten, nicht denen eines Touristen und auch nicht mit denen einer abituée, sondern immer auf der Suche nach neuen architektonischen Reizen. Dass ihre Ausstellung hier in den Räumen der Architekten stattfindet, erscheint mir daher als eine schöne und stimmige Würdigung. „Sie kommen, um zu sehen, und Sie werden gesehen, heißt es in der Einladung“. Ich habe Elisabeth Brockmann das erste Mal vor mehr als zehn Jahren gesehen, d.h. sie kennen gelernt, nicht als die Künstlerin, als die sie heute hier geehrt wird, sondern als Bühnenbildnerin. Sie hatte für Hanna Schygulla in Elfriede Jelineks Stück „Begierde und Fahrerlaubnis“ ein Bühnenbild entworfen, in dem die Wände nur aus Spiegeln bestanden, so dass die Schauspielerin sich darin in unendlichen Vervielfältigungen wiederholend bewegte. Hanna Schygulla spielte eine Art Prostituierte in einem schwarzen Lack-Body, der Mantel ebenso schwarz mit knallrotem Futter, und durch die Spiegelungen entstand der Eindruck, dass es sich nicht nur um diese eine Person handelte, sondern um eine multiple Persönlichkeit, um die man außerdem noch, wie mit einer Handkamera gefilmt, herumgehen, sie umkreisen konnte.
Man sah ihren Rücken, ihr Profil, ihr Gesicht, alles gleichzeitig und in die Unendlichkeit hinein sich verkleinernd. Als Betrachter konnte man wählen, ob man die „reale“ Person ansehen wollte oder nur ihre vielen Erscheinungen. Zum Zuschauerraum hin war Hanna durch eine Glaswand getrennt, so dass die Wirkung entstand, als säße sie in einem Käfig. Eine Gefangene, und zugleich ein Objekt der Begierde, das aus dem Dunkel des Zuschauerraums heraus genüsslich betrachtet werden konnte. Doch dann änderte sich das Licht, auch das hatte Elisabeth Brockmann inszeniert, und die Zuschauer spiegelten sich in der Glaswand, wurden mit sich selbst konfrontiert und fühlten sich plötzlich wie die Voyeure in einer Peep-Show. Die Wirkung war verblüffend. Erst suchten sie sich selbst im Spiegel zu erblicken, dann die anderen zu erkennen, die neben oder hinter ihnen saßen, aber schon wurde der Effekt zurückgenommen, und Hanna war wieder mit sich und ihren Doppelgängerinnen allein. Kurze Zeit später hat das Théatre des Amendiers in Paris die Aufführung übernommen. Da es sich um ein sehr kurzes Stück handelte, wurde ich gebeten, ein zusätzliches Stück, von Jean-Claude Carriere, ebenfalls mit Hanna Schygulla, zu inszenieren. Das Bühnenbild von Elisabeth Brockmann sollte sich nicht verändern. Mit dieser Einschränkung waren weder Elisabeth noch ich sehr glücklich. Was tun, ohne dem Theater zusätzlichen Aufwand und Kosten aufzubürden. Elisabeth hatte die geniale Idee, die Spiegelwände so aufzuschneiden, dass sie zu Drehscheiben umgewandelt werden konnten, deren Hinterseiten stumpf waren, man sich also in ihnen nicht spiegeln konnte. Das gab mir die Möglichkeit, dass Hanna Schygulla je nach Situation im Stück sich ansehen konnte, um sich selbst zu erforschen oder ratlos, verwirrt und wie vor den Kopf gestoßen unerwartet vor einer kahlen, weißen Wand stand. Sie spielte in dem Stück eine der ersten Christinnen, die ihre Familie verlässt, um Gott in der Wüste zu suchen, sich aber immer nur selbst begegnet. Auch diesmal hat Elisabeth Brockmann den Effekt des sich selbst betrachtenden Publikums beibehalten, nur wurden die Zuschauer dabei nicht zu Voyeuren, sondern aus der fernen Vergangenheit in die Jetztzeit zurückkatapultiert. Das war Elisabeths und meine bisher einzige gemeinsame Arbeit. Was uns geblieben ist: eine Freundschaft, in der wir uns ansehen wie in einem Spiegel. Überhaupt die Augen. Wie die tausend Augen eines Doktor Mabuse. Aber es sind keine Augen, die einen bespitzelnd überwachen wie bei Fritz Lang, sondern einen auffordern, in sich selbst hineinzublicken. Es gibt ein Spiel mit sich selbst, das manchmal zu bitterem Ernst werden kann. Man sieht in den Spiegel, aber nicht, um sein Aussehen zu überprüfen, sondern um sich selbst in die Augen zu blicken, nur in die Augen. Lange. Sehr lange. Nur in die Augen. Und allmählich wird man zu einer fremden Person, zu einem Gegner, einem Feind, der einem das verborgene Ich, den Schatten, offenbart, und man wird aufgesogen in eine Spirale hinein, und plötzlich steht man jenseits des Spiegels, wie bei Jean Cocteau, wo Jean Marais durch einen flüssigen Spiegel hindurchgeht und ins Reich der Toten gelangt. Dabei lauert die Gefahr, dass man nicht mehr zurückfindet. Bei manchen Selbstbildnissen, z.B. denen des Belgiers Leon Spilliaert, kann man sich vorstellen, dass der Maler das Spiel mit sich gespielt hat, und das Schaudern vor der eigenen Existenz dabei erfahren hat.
Wer die Augen von Elisabeth Brockmann ansieht, hat die Wahl, sich von ihnen nur betrachten zu lassen oder auf sich selbst verwiesen zu werden und den Blick nach innen zu lenken auf das Unbekannte, das uns Angst macht. Meine Freundin Elisabeth kennt die Angst, die vor der Welt und die vor sich selbst, aber sie wird ihr immer mit offenen Augen entgegenblicken. Sehen und sich dabei selbst erblicken. Ich denke, sie lädt uns ein zu diesem Wagnis, bei dem wir am Ende sozusagen als Belohnung, sogar über eine schmale Treppe zum Himmel aufsteigen dürfen….